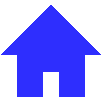Reiseberichte
Navigation: Übersicht / AFRIKAS SÜDEN UND DIE INSELN DES INDISCHEN OZEANS
DIEBISCHE HELDEN UND AFFEN
Da Geri früher wieder auf den Beinen ist und Sylvia diese Gegend schon vor sieben Jahren besucht hat, unternimmt er allein einen Ausflug in den Parc National de Ranomafana, in dessen üppigem Bergregenwald bemerkenswerte Pflanzen- und Tierarten beherbergt sind. Er hat das Glück, den Grauen Bambuslemur zu entdecken, außerdem den Milne Edwards Sifaka, den Rotbauchmaki und den Rotstirnmaki.
Anderntags bricht er zu einer zweitägigen Tour mit der spektakulären Dschungeleisenbahn auf.
Eine Fahrt mit dem Dschungelexpress vom Hochland zur Ostküste ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Am 1.April 1936 wurde die Strecke eröffnet, seitdem ist der Zug des Lebens unterwegs, auch um Kranke in den nächsten Ort zu transportieren.
Für die Strecke von 163,4 km braucht der Zug meistens über 14 Stunden, es gibt 67 halsbrecherisch wirkende Brücken und 48 Tunnel, der längste ist mehr als einen Kilometer lang. Reparaturmaterial wird stets mitgeführt, da man nie weiß, ob es einen Erdrutsch gab, Gleise heimlich ausgebaut wurden oder die Lok den Geist aufgibt. Fast immer muss die alte Diesellok unterwegs ein paar Stunden anhalten, sei es, dass ein Brückenpfeiler überprüft, ein umgestürzter Baum beiseite geschoben, oder Fracht umgeladen werden muss.
Die altersschwachen Lokomotiven winden sich in beängstigend steilen Serpentinen die Ostabhänge hinunter, passieren anfänglich Wiesen, Reisfelder, Teeplantagen, dichte Wälder und Seen, bevor sie in den Regenwald eintauchen, der in die Ebenen der Küste übergeht.
Mit fast dreistündiger Verspätung setzt sich der Zug unter lautem Gejohle der Anwesenden in Bewegung, Geri hat jedoch die Absicht schon bei der fünften Station auszusteigen und von dem kleinen Dörfchen Andrambovato in den 300m niedrigeren Ort Ambalavero zu wandern, und damit in eine andere Welt. Während oben die Häuser aus Holzbrettern erbaut sind, findet man hier Häuser mit Wänden aus Strohmatten, teils mit Lehm verputzt.
Das erste Haus ist eine evangelische Kirche, aber gleich daneben ein noch in Gebrauch befindlicher heidnischer Schwurstein! Und während die meisten Dörfer schon moderne Dorfvorsteher haben, regiert hier noch nach alter Tradition eine lokale Königin, ein älteres, zartes Persönchen, das die Geschicke und Rituale ihres Dorfes lenkt und Geri zu sich einlädt.
Am nächsten Tag geht es noch auf steilen Dschungelpfaden auf den 1185 m hohen Ambonivato und zu den malerischen Mandriampotsy-Wasserfällen.
Nachdem wir der auf einem Hang liegenden Oberstadt in Fiana noch einen Kurzbesuch abgestattet haben, brausen wir vom terrassierten Hochland durch das Tor des Südens in eine völlig andere Landschaft. Die Abschnitte zwischen den Ansiedlungen werden jetzt größer, denn in den weiten Savannen und Wüsten leben weniger Menschen als im Hochland. Rinderherden weiden rechts und links der Straße auf unendlich scheinenden Grasflächen, Hirten sitzen mit Stöcken und Äxten bewaffnet am Straßenrand, denn hier beginnt das Land der Bara, der Rinderzüchter und Rinderdiebe.
Der Besitz von Rindern ist mehr noch als bei anderen Völkern Statussymbol. Bis heute ist es Brauch, dass ein junger Mann, der um die Hand einer Frau anhält, die meisten Chancen hat, wenn der Brautwerber berichten kann, dass er bereits viele Rinder gestohlen hat, denn dann ist er imstande seine zukünftige Familie zu beschützen und zu ernähren. Rinderdiebstahl steht also für Männlichkeit und Mut. Als Beweis sind Entlassungspapiere aus dem Gefängnis sehr beliebt.
Die Grassteppen werden nun von gigantischen Granitfelsen und Flussläufen unterbrochen, in denen sich von Grün umgebene Dörfer unter Mangobäumen, Bananen- und Papaya-Stauden ausbreiten, nur vereinzelt findet man von Betsileos betreute Reisfelder. Am Nachmittag erreichen wir Ranohira, ein paar Läden, einige Hotely Gasy, zwei Kirchen und Schulen, ansonsten ärmliche Hütten. Vom Bänkchen neben unserem Bungalow genießen wir einen traumhaften Blick über die Wiesen zum über 40 km langgezogenen Abbruch des unglaublich spektakulären Sandsteingebirges von Isalo.
Nachdem wir im Morgengrauen wieder einmal Spinnen, haarige Raupen und Frösche aus Bettstatt und Zimmer entfernt haben, legen wir mit einem zerbeulten Gefährt 17 km auf sandiger Piste, quer durch die Wiesen hin. Beim Aussteigen wird es dann etwas schwierig, denn es kann lediglich eine Türe, und nur von außen mittels Draht durchs Fenster, geöffnet werden, afrikanisch eben, meint lachend der Fahrer. Dafür lässt sich die Scheibe mit der Hand locker hin und her schieben, die Vorrichtungen dafür sind längst abgebrochen.
Zwischen hohen Gräsern, über frische, klare Bächlein, in idyllischen Oasen mit Palmen, balancierend und unter Schatten spendenden Mangobäumen geht es zu Fuß bis zum Eingang des Canyons, zum Tal der Affen, weiter. Schon turnen in den Ästen die ersten Braunen Makis über unseren Köpfen und blicken mit treuherzigen Augen auf uns hernieder. Zwischen feuchten, grün bewachsenen Felswänden klettern wir über riesige Felsbrocken zwischen immer enger werdenden Schluchten aufwärts, verweilen bei malerischen Sandbänken, anschließend geht es den steilen, in Serpentinen gewundenen Pfad zur Kante des bizarren Hochplateaus auf 1100 m hinauf.
Unterwegs treffen wir auch auf die wenig scheuen Kattas, allerliebst mit ihren prachtvollen, weiß-schwarz geringelten langen Schwänzen, die sie entweder hoch erhoben tragen oder ausgiebig putzen, jedenfalls sind sie sich ihrer Exklusivität bewusst. Ein frischer Wind bläst über die Anhöhe und wenn Wolken die Sonne verdecken, ist es direkt kalt.
Stundenlang wandern wir auf der in nahezu mystischer Stille schwebenden Hochebene auf teils in den Stein gehauenen Stufen auf und ab, entzücken uns an Zwergbaobabs und Euphorbien, Gewächse, die Jahre ohne Regen auskommen können. Unerschöpflich sind die fantastischen Felsskulpturen, aus weichem Sandstein aufgeworfen. In Jahrmillionen hat der Regen tiefe Schluchten gegraben, in denen Bäche, Quellen und kleine Seen mit tropischer Vegetation, Palmen und meterhohen Farnen, entstanden sind.
Froh sind wir, als wir der Hitze entkommen und in einen engen schattigen Canyon absteigen, eine Abzweigung führt zum Nymphen-Wasserfall, der sich in einem von mit grünem Moos überzogenen Felswänden begrenzten Becken ergießt.
Müde kommen wir bald darauf im Lager an, unser Zelt ist schon aufgestellt, es gibt heißen Tee und Nüsse, etwas später wird Suppe serviert, gefolgt von Kartoffeln mit Gemüse, Ananas und Bananen zum Nachtisch, dann liegen wir auch schon in unseren Schlafsäcken und gleiten ins Land der Träume, hoffend, dass sich keiner der hier zahlreichen Skorpione in unser offenes Zelt, der Zippverschluss ist leider abgebrochen, verirrt. Aber schließlich schlafen unsere beiden Begleiter gänzlich im Freien, lediglich auf einer Matte.
Durch lautes Kreischen erwachen wir zeitig am Morgen, eine Bande von Braunen Makis treibt auf den Ästen über uns ihr Unwesen. Ein Frecher hüpft sogar auf den für uns gedeckten, steinernen Frühstückstisch, aber man kann ihnen nicht böse sein, sie sind gar zu drollig!
Es geht wieder aufwärts und entlang der Felsen mit herrlichen Ausblicken in die Tiefe und Weite dieser einzigartigen Landschaft bis zu einer mit einem natürlichen Schwimmbecken ausgestatteten Oase, in der sich auch einige Lemuren tummeln.
Beim Abstieg passieren wir Grabhöhlen, eine davon befindet sich in schwindelnder Höhe in einem Felsen. Nur mittels Seilwinde können die Verstorbenen dorthin transportiert werden.
Natürlich wollen wir auch das Saphir-Städtchen Ilakaka besuchen: Seit 1997 eine einheimische Familie den ersten Saphir gefunden und erkannt hatte, wurde der Ort als Banque Suisse bezeichnet und galt als vermutlich reichstes Edelsteinfundgebiet der Welt. Unter dem Einfluss des Saphirrausches verwandelte er sich in eine unkontrollierbare Wildweststadt, in der Soldaten zur Sicherheit und um illegalen Verkauf und Schmuggel einzudämmen, abgestellt werden mussten.
Doch was ist bloß aus dem wie im Wilden Westen anmutenden Ort mit schwunghaftem Handel geworden! Die vergitterten Steinhäuser, in denen Frauen wertvolle Steine anboten, gibt es nicht mehr, nur mehr einzelne Geschäfte von Thailändern und Indern entlang der Hauptstraße, die im Wesentlichen von verlotterten Bretterbuden gesäumt ist, Menschen hocken im Rinnsal und Dreck, resigniert im Elend versunken.
Der kleine Markt in einer Seitengasse schlägt alles, was wir bis jetzt an Unerträglichem und Unappetitlichem gesehen haben: Von Fliegen übersäte Gedärme und Innereien aufgehäuft, ein Bottich mit Heuschrecken, die durch abgerissene Beine am Wegspringen gehindert werden. Uns dreht sich schier der Magen um! Am meisten erschreckt uns aber die offensichtliche trostlose Lethargie, die können wir nicht verstehen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|