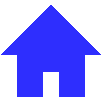Reiseberichte
Navigation: Übersicht / AFRIKAS SÜDEN UND DIE INSELN DES INDISCHEN OZEANS
WECHSELBAD DER GEFÜHLE
Nach einer Woche steuern wir MADAGASKAR, die geheimnisvolle Insel der Piraten, Zauberer, Heiler und Geister an. Über 20 Volksgruppen leben hier, alle huldigen verschiedenen Ahnenkulten. Landschaften und Leute – so bunt wie ein Bilderbuch! Tonga Soa, Vazahas!
Hektik und Getriebe herrscht auf dem kleinen Flughafen der Hauptstadt Antananarivo, es dauert eine Weile, bis wir alle Zettel ausgefüllt haben und mit dem Gepäck hinausmarschieren. Gleich hängen etliche Taxifahrer wie die Kletten an uns, weichen auch beim Geldautomaten nicht von uns, der aber ohnehin nicht funktioniert.
Tana liegt auf 1250 m Höhe und wurde vom Merina-König Andrianjaka zu Beginn des 18.Jh. erbaut. Der Einfluss europäischer Architekten ist bis heute im Baustil der Stadt sichtbar. Erst nach dem 2. Weltkrieg wurde die Stadt zu einer Millionenmetropole. Das unkontrollierte Wachstum führte schnell zu Chaos, Enge und Schmutz. Aber es ist das Leben auf der Straße, die Gerüche und Düfte der feilgebotenen Speisen, auch der Kontrast von Armut und ausgeprägter Lebenslust und Heiterkeit, die der Stadt ihren eigenständigen, faszinierend fremdartigen Charakter verleihen.
Entlang winziger Wellblechhütten und Bretterverschlägen geht die Fahrt mit einem klapprigen 2CV zunächst dahin, dann weitet sich die Straße, wird von auf einem Damm befindlichen Ziegelbrennereien und Nassreisfeldern begrenzt. Rundum schmiegen sich winzige, farbenfrohe Behausungen an den Hängen empor, ein entzückender Anblick! Doch der Schein trügt!
Es herrscht reges Marktgetriebe, die steilen Gassen quellen förmlich über an Ständen, viele Frauen, umringt von in Lumpen gehüllten Kindern, hocken einfach am Boden und bieten da ihre oft kärglichen Waren an oder halten bettelnd die Hände auf. Eine alte Frau stillt aus einer Bodenlache ihren Durst, die Bilder sind erschreckend! Seit den politischen Unruhen in den vergangenen Jahren hat sich die Armut deutlich erhöht.
Unser Fahrer quält sich in Zeitlupentempo durch den Stau die engen Gässchen in Kehren bergauf, bis wir schließlich vor unserem Hotel landen, eine wohltuende Oase, mit Blick auf den Rowa, den Königinnenpalast.
Vorerst wollen wir die Stadt erkunden, werden aber gewarnt, nur ja keine Wertsachen mitzunehmen. Über einen Treppenaufgang, zu beiden Seiten Geschäftchen wie Höhlen ins Erdgeschoss gehauen, die meisten etwa einen Quadratmeter groß, gelangen wir zur Avenue de l’Independance und weiter zum Lac Anosy, zwar idyllisch gelegen, aber der Geruch von Fäulnis und Kloake zieht sich weit über den umgebenden Park. Dazwischen finden sich durchaus auch moderne Viertel mit Villen, Hotelanlagen und Geschäften mit westlichem Standard.
Nicht unproblematisch ist die Fahrt mit den öffentlichen Buschtaxis in den Süden, denn Überfälle passieren immer wieder, vornehmlich nachts, auch wenn da nur im Konvoi gefahren wird.
Wir lassen uns aber dadurch nicht abschrecken und begeben uns alsbald zu einer Taxi Brousse Station in einem Vorort Tanas. Angekommen, wird in üblicher Weise gleich auf uns eingestürmt, im Nu sind zwei Sitzplätze im Kleinbus für uns vorhanden, auch wenn wir zu viert in einer Reihe eingequetscht sitzen, wo höchstens für drei Leute Platz ist, die zwei großen Rucksäcke werden am Dach auf den schon meterhohen Ballast aufgegupft und festgebunden. Für die rund 170 km lange Fahrtstrecke zahlen wir umgerechnet 3 € pro Person.
Wir müssen auch gar nicht lange warten bis zur Abfahrt, mit 21 Personen sind wir einstweilen vollständig, weitere werden auf der Fahrt dazukommen. Zwei Reihen vor uns haben ein paar Burschen Platz genommen, jeder mit einem Hahn unterm Arm, die gehen natürlich sofort aufeinander los und müssen erst beruhigt werden.
Nach einiger Zeit sind wir der Stadt endgültig entflohen, Reisfelder tun sich vor uns auf, saftig grüne Wiesen in hügeliger Landschaft eingebettet, adrette Häuser mit gepflegten Gärtchen prägen das Erscheinungsbild. Angesichts dieser reizvollen Idylle fragt man sich, was wohl die Leute in den Sumpf der Stadt treibt, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen dahinvegetieren.
Angehalten wird nicht nur bei den zahlreichen Polizeikontrollen, angeblich zahlt hier jeder Fahrer einen gewissen Obolus, damit er untertags unbehelligt bleibt, sondern auch in einem kleinen Dorf, die Hähne dürfen sich die Füße vertreten, wir auch. Sofort eilen Frauen und Mädchen heran, die gebratene Hühnerstücke und Bananen auf Tabletts anbieten.
Auf guter Asphaltstraße brettern wir dann weiter, beiderseits steigen Reisterrassen an, Wasserfälle sprudeln in den träge dahin strömenden Fluss, dazwischen liegen von Dämmen und Kanälen durchzogene Felder in vielfältig schattierten Grüntönen.
Zunehmend erhalten auch die Häuser ein anderes Aussehen: Stroh gedeckte, rötliche, mehrstöckige Ziegelbauten, ohne Verputz und mit winzigen Fensterlöchern, teils mit Holzläden, thronen wie kleine Trutzburgen, meistens zu Gehöften zusammengeschlossen, in dem lieblichen Ambiente. Wir können uns gar nicht sattsehen und vergessen dabei die Beschwerlichkeit der Reise.
Wir durchfahren einen Lärchenwald, auch hier wieder ein Potpourri an Farben auf den Hochebenen. Am Straßenrand werden Tomaten, Orangen und Äpfel verkauft, alle fein säuberlich, abwechselnd nach Farben, zu pyramidenförmigen Häufchen geschlichtet. Besonders entzückend sind die aus Altmetall hergestellten, bunten Lastwagen, als Kinderspielzeug oder Souvenir gedacht, am liebsten würden wir anhalten!
Nach einer Übernachtung in Antsirabe finden wir uns erneut am Busbahnhof ein, doch diesmal hängen wir zwei Stunden herum, bis die Karre endlich voll besetzt ist, nach kürzester Zeit gibt sie aber dann auch noch den Geist auf und wir müssen in eine andere Rostlaube wechseln. Mora, Mora – nur Geduld!
Ziemlich kurvig verläuft diesmal die Straße, wir verfolgen die wechselnde Landschaft und es wird uns bewusst, wie hart und unter welchen Umständen der Großteil der Menschen auf den Feldern arbeitet: Mit Harken und Spaten werden die Erdschollen gelockert, gerade ist auch Getreideernte. Die von Hand geschnittenen Halme werden zu Büscheln gebunden, an Holzbrettern werden die Körner ausgedroschen und im Hof oder sogar auf dem Asphalt zum Trocknen aufgelegt. Auch die Kleinsten müssen mithelfen, den Frauen obliegt es, die Körner im Mörser zu zerstoßen.
Etliche waten im Schlamm der nassen Reisfelder und bearbeiten die zartgrünen Halme. Es gibt keinerlei Gerätschaften, Ochsenkarren ziehen die schweren Lasten. Unzählige Leute sind am Straßenrand unterwegs, mit Gütern am Kopf oder auf den Schultern, für sie ist selbst das Buschtaxi zu teuer. Manche haben sich kleine Handwägelchen aus Brettern gebastelt, sogar mit Lenkrad und Bremse, damit sie bergab auch darauf Platz nehmen können.
Kein Wunder, dass viele in die Städte abweichen und glauben, dort das bessere Los zu ziehen, welch fataler Irrtum! Unweigerlich gerät man ins Grübeln, was für Dimensionen da zwischen den Welten liegen! Während die einen den harten Kampf ums Überleben aufnehmen und trotz allem auch noch recht fröhlich wirken, lassen andere sich hängen und dem Schicksal freien Lauf. Und dann drängen sich auch noch Gedanken an den Überfluss in unserer westlichen Welt auf, und was wir daraus machen…
Zunehmend gelangen wir in einsame und kahlere Hochgebirgsregionen, Zebu-Herden mit ihren Hirten und deren Familien begegnen uns auf der Straße, sie ziehen nach Tana zum Rindermarkt, hunderte Kilometer!
Verschwitzt und ausgelaugt biegen wir endlich nach 250 km in den Busbahnhof von Fianarantsoa ein und finden dort ein ansprechendes und sauberes Zimmer. Das ist auch gut so, denn wir werden leider nun für fast eine Woche das Bett hüten müssen. Neben Fieber und Schüttelfrost machen sich Symptome von Grippe und auch noch Durchfall bemerkbar.
Ein Angestellter des Hotels empfiehlt uns die öffentliche Klinik, gleich in der Nähe, ein Erlebnis für sich! Nachdem wir beim Schalter unsere Daten auf ein Formblatt eingetragen, 3€ bezahlt und ein Heftchen für Eintragungen gekauft haben, werden wir zum ersten Zimmer entlang eines Ganges im Innenhof geschickt. Dort wartet ein Tribunal, bestehend aus fünf geistlichen Schwestern. Auf einer altertümlichen Brückenwaage wird unser Gewicht festgestellt, Fieber gemessen und mittels Pumpgerät, das an eine Quecksilbersäule angeschlossen ist, der Blutdruck ermittelt. Das völlig falsche Gekritzel der Daten in das Heftchen lässt dann allerdings darauf schließen, dass hier keiner wirklich des Schreibens mächtig ist! Es wäre ja fast erheiternd, wenn es uns nicht so mies ginge!
Nun werden wir eine Tür weiter geschickt: Ein schmächtiges Bürschlein soll uns auf Malaria testen. Scheinbar hat er das noch selten gemacht, denn nervös zieht er den Alkoholtupfer aus der Verpackung, von steril kann da weiter gar keine Rede mehr sein. Geri nimmt ihm die Nadeln aus der Hand und vollführt den Stich in den Finger lieber selbst, gleich für uns beide, danach erhalten wir ein Wattebäuschchen, aus einer undefinierbaren Schachtel gezupft. Während der ganzen Prozedur wird neben uns ein junger Mann an der Lunge punktiert.
Nach dem gottlob negativen Ergebnis sitzen wir eine Weile vor der letzten Tür, hinter der sich eine junge Ordensschwester verbirgt, die erstmalig Fragen nach unseren Beschwerden stellt. Schließlich machen wir ihr den Vorschlag, Antibiotika, Husten- und Grippemittel zu verschreiben. Die von ihr angegebene Dosierung ist allerdings so hoch, dass diese, wie wir später recherchieren, ein Pferd umbringen könnte. Die Pülverchen erhalten wir abgezählt gleich dort, Kostenpunkt für das Antibiotikum sind 60 Cent!
|
|
|
|
|
|
|
|
|