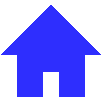Diabetes
Navigation: Übersicht
"Sie haben keine Chance, das zu überleben!"
oder
Die Macht der Dämonen im Kopf
Eigentlich war ich gar nicht so sehr erschüttert, als ich die Diagnose meines Hausarztes hörte: „Diabetes - zuckerkrank!“ Zum einen wusste ich in diesem Moment recht wenig mit dieser Diagnose anzufangen, zum anderen war ich erleichtert, keine schlimmere Diagnose zu hören. Innerhalb von nur vier Tagen hatte sich mein Sehvermögen derart verschlechtert, dass ich nicht mehr ohne Führung auf der Straße gehen konnte. Nun erfuhr ich von meinem Hausarzt, dass nicht eine Augenkrankheit an meinem Zustand schuld war, sondern der extrem hohe Blutzuckerspiegel. Besser Diabetes als Blindheit, das war für mich klar.
Wenige Stunden später war ich im Krankenhaus, wo die nötigen Labortests durchgeführt wurden. Ich wurde ins Arztzimmer gerufen, wo die Erstdiagnose meines Hausarztes bestätigt wurde. Gleichzeitig erfuhr ich einiges mehr über meinen neuen Lebensbegleiter: die nächsten Wochen werde ich im Spital zubringen müssen, mein ganzes Leben werde ich Insulin spritzen müssen und meinen Lebensstil und -rhythmus werde ich ändern müssen. Nun, das alles klang nicht gerade verheißungsvoll, aber was mich wirklich „knickte“, war der Tonfall, in dem mir das alles mitgeteilt wurde. Gut gemeint war es sicher, ein Versuch persönlicher Anteilnahme an meinem Schicksal, aber dieses langsam gesprochene „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie zu einem der wenigen Fälle gehören, die....“ warf mich total zurück. In meinem bisherigen Leben habe ich nicht allzu viel von Regelmäßigkeit gehalten, ich liebte die dauernde Abwechslung. Gerade erst war ich sieben Monate durch die Welt getingelt, ohne dabei eine geplante Route verfolgt zu haben.
Nun sollte das alles vorbei sein. Zwar wurde immer wieder die Bedeutung sportlicher Aktivität für Diabetiker betont, doch hörte sich das alles eher nach Seniorengymnastik an, für die ich mich noch zu jung fühlte. Joggen ja, aber nicht zu lang und nicht zu kräfteraubend; schwimmen ja, aber nicht allein; in die Berge gehen ja, aber nicht zu weit weg vom nächsten Versorgungsposten, und schon gar nicht klettern! Zwar konnte mir kein Arzt klarlegen, warum ich mit diesen so geliebten Freizeitbeschäftigungen als Diabetiker nun schlechter zu Rande kommen sollte, aber die dauernden Warnungen vor Blutzuckerschwankungen, Hypos und unsachgemäßer Insulinlagerung prägten doch auch bald mein Denken. Ich wollte es nicht glauben, ich wehrte mich, ich flüchtete mich in das Lesen abenteuerlicher Großtaten, aber letztlich hatte ich keine Chance. Schon kurz nach meinen ersten Insulinspritzen hatte mich die erste Folgeerkrankung des Diabetes mellitus ereilt: sie hatte sich in meinem Kopf festgesetzt und sagte mir immer, dass ich bei meinen sportlichen Aktivitäten und bei meinen Reisen Beschränkungen hinnehmen müsse - nur weil ich Diabetiker bin. Und wollte ich etwas so tun, wie ich es früher getan habe, dann bedurfte es, so meinte ich zumindest, einer gewaltig riskanten Mutprobe - nur weil ich Diabetiker bin.
Dämonen hatten sich in meinem Kopf festgesetzt, sie lähmten meine Entschlusskraft, sie wirkten auf meinen Körper ein, sie beieinflussten ihn so stark, dass er ihnen schließlich recht gab. Ein ganz normaler Campingurlaub quer durch Griechenland wurde schon fast zum Stolperstein für mich. Riesige Blutzuckerschwankungen, und das obwohl die griechische Kost relativ leicht berechenbar war und Insulin und BZ-Messgerät in Ordnung waren. Ich war ganz im Bann der BZ-Werte in Form von Zahlen und musste mir sagen: Nicht einmal das kann ich nunmehr tun. Natürlich weiß ich heute, dass damals eine lang anhaltende Zahnentzündung für das Durcheinanderwirbeln der BZ-Werte verantwortlich war, heute wüsste ich mit meiner NIS-Schulung auch besser damit umzugehen. Damals redeten mir aber die Dämonen im Kopf ein, dass ich als Diabetiker nicht einmal einen normalen Campingurlaub in Griechenland durchstehen könne.
Wie sollte das weitergehen? Sollte es im Laufe der Jahre etwa noch schlimmer werden? Bliebe dann nicht ein bisschen wenig vom Leben übrig?
Von allen Neujahrsvorsätzen in meinem Leben habe ich keinen wirklich durchgebracht, außer einen: mit dem 1.Januar 1987 beschloss ich, es noch einmal zu versuchen, mein Leben mit Diabetes in die von mir gewünschte Richtung zu lenken. Und ich war auch bereit, einiges dafür zu tun. Ich begann mit einem konsequenten Lauftraining, um körperliche Ausdauer aufzubauen. Bisher war ich stets 5-6 km gelaufen und das recht schonend, um eine Hypoglykämie auf jeden Fall zu vermeiden - streng nach Vorschrift. Mehr sei nicht mehr drinnen, so hatte man mir gesagt. Schon nach wenigen Wochen merkte ich, dass ich ohne weiteres 14-15 km in zügigem Tempo durchhalten konnte. Als ich dann im März bereits 30 km ohne Probleme und ohne Hypo durchstand, war für mich klar, die Nennung für den Wien-Marathon im April abzugeben. Nun sollte es also über 42 km im größtmöglichen Tempo gehen und da wollte ich doch noch medizinischen Rat einholen. Gefühlsmäßig wusste ich, dass ich etwas an meiner Insulinmenge ändern musste, aber ich hatte keinerlei Schulung, in welchem Maße ich das tun musste. Ich rief in meiner Klinik an, erzählte meinem Arzt, dass ich am nächsten Sonntag beim Wien-Marathon starten werde und bat um eine Dosisanpassung. Seine Antwort war klar: „Sie haben keine Chance, das zu überleben!“ Zu spät kam dieser ärztliche Einspruch, zu fest war ich entschlossen zu starten, und schließlich hatte ich die Nennung auch schon abgegeben. Mein Arzt sah, dass er mich von meinem Vorhaben nicht abbringen konnte und so empfahl er mir etwas zähneknirschend an diesem Tag nur die halbe Insulinmenge zu spritzen. Ich hielt mich an diese Anweisung, trieb vor dem Start den Blutzucker noch auf ca. 200 mg/dl und lief den Marathon ohne wirkliche Probleme durch.
Was hatte sich nun durch das Erreichen der Ziellinie für mich verändert? Lange vor dem Rennen redeten mir die Dämonen im Kopf ein: ein Diabetiker kann keinen Marathon laufen! Als sie dann später sahen, dass ich entschlossen war, impften sie mir zumindest die Skepsis ein, dass ich etwas Unmögliches und Riskantes versuchen wolle. Nach dem Rennen meldeten sich die Dämonen in Sachen Marathon nie mehr zu Wort. Bei den nächsten Marathon-Läufen verschwendete ich nicht den geringsten Gedanken daran, dass ich ihn als Diabetiker laufe. Der Marathon bleibt für mich wie wohl für jeden Teilnehmer eine besondere Herausforderung. Diese Leistung wird aber um nichts beachtenswerter durch die Tatsache, dass ich Diabetiker bin. Warum sollte ich als Diabetiker schlechter laufen als der Nichtdiabetiker? Den Umgang mit möglichen Unterzuckerungen lernt man sowieso, fast nebenbei, in der Trainingsphase.
Nun, die Dämonen blieben weiterhin in meinem Kopf. In Sachen Marathon meldeten sie sich nie wieder zu Wort. Aber da gibt es eine ganze Menge von Dingen im Leben, die für einen Diabetiker als riskant gelten, die aber unheimlich viel Spaß machen. Sobald ich mich einem dieser sogenannten Tabus auch nur gedanklich näherte, hörte ich wieder die Stimme der Dämonen, die mich auf meine „Behinderung“ hinwiesen. Das Spiel der Dämonen mit mir verlief immer nach dem gleichen Ritual und es sollte weitere sieben Jahre dauern, bis ich es endlich durchschaut hatte. Wenn ich mich an eine Aktivität, die für Diabetiker als gefährlich gilt, herantastete, so sagten die Dämonen, dass diese Aktivität gänzlich unmöglich für mich sei. Später dann, wenn ich schon recht gut auf diese Aktivität vorbereitet war, ließen sie alle nur möglichen Gefahren und Komplikationen durch meinen Kopf schwirren, was mich immer wieder unsicher machte. Wenn ich die Aktivität dann zum ersten Mal durchgestanden hatte, hörte ich die Stimme der Dämonen nie wieder, aber eben nur in bezug auf diese eine Aktivität. Rückblickend betrachtet war es für mich nicht schlecht, dass mich mein Arzt durch seine wohl weit übertriebene Aussage „Sie haben keine Chance, das zu überleben!“ von meinem Vorhaben abbringen wollte. Dass ich es dann trotz dieser Prognose schaffte, gab mir Mut, immer Neues zu versuchen. Auf diese Weise hatte ich bald meine vordiabetische Lebensqualität wieder erreicht. Ich konnte wieder mit dem Rucksack durch alle Weltteile reisen, konnte wochenlang durch das Hochgebirge oder den Dschungel wandern, konnte wieder bergsteigen, konnte wieder klettern; neue, für mich bisher nicht bekannte Freizeitvergnügungen kamen hinzu, so z.B. Paragleiten und Tauchen. Der Umstieg von der konventionellen Therapie zu NIS war für all diese Aktivitäten von unschätzbarem Wert.
Wenn ich immer wieder von den flüsternden Dämonen in meinem Kopf rede, so spiegeln sie eine Schwäche in meiner Einstellung zum Diabetes wieder. Die Dämonen konnten nur überleben, weil ich im Diabetes eine einschränkende Behinderung sah. Diese falsche Sichtweise wurde gefördert durch die Art und Weise, wie mit den Themen „Diabetes und Sport“ bzw. „Diabetes und Reisen“ in der einschlägigen Literatur umgegangen wird. Wenn etwa für eine zweistündige Aktivität in einer Standardsportart drei bis vier BZ-Messungen „obligatorisch“ vorgeschrieben werden (knapp vorher, während, knapp nachher, einige Stunden später) und die Form der BE-Zufuhr ebenso streng geregelt wird (unter bestimmten Umständen Milch, unter anderen Umständen Obstsaft), wird das Gefühl der Behinderung für den Diabetiker nur gefördert. Solche „Vorschriften“ sind in der einschlägigen Literatur eher die Regel. Zum einen werden viele Diabetiker bei so viel Aufwand auf die sportliche Aktivität verzichten, zum anderen wird der Diabetiker durch solche Regeln von vielen sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen. Wie soll ein Bergsteiger, der sieben Stunden in einer Eiswand zubringt und nie mehr als eine Hand freibekommt, und diese ist mehrfach in Handschuhe und Fäustlinge eingepackt, die vielen BZ-Messungen durchführen, wo soll er plötzlich Milch oder Obstsaft herzaubern?
Vor zwei Jahren unternahm eine deutsche Bergsteigergruppe eine Expedition zum Muztagh Ata, einem 7546 Meter hohen Berg in der chinesischen Provinz Xinjiang. Ich hatte rechtzeitig von der Ausschreibung gehört und um Aufnahme in die Expedition gebeten. Allerdings konnte ich nicht ernsthaft damit rechnen, in die Gruppe aufgenommen zu werden, da man dem eigentlichen Antrag eine Liste bisheriger Bergerfolge und ein ärztliches Attest beilegen musste. Ich hatte in den letzten Jahren fünf Gipfel mit mehr als 6000 Metern bestiegen und das war gar nicht so schlecht für die Antragstellung, aber wie sollte das mit meinem ärztlichen Attest klappen? Doch welche Überraschung: plötzlich hatte ich es mit Menschen zu tun, die nur mich beurteilten, und nicht mich minus Diabetes. Da war zuallererst mein Hausarzt, der im Attest betonte, dass ich alle Sechstausender als Diabetiker bestiegen hatte und dass er deshalb meine Teilnahme an der Muztagh Ata-Expedition befürwortete. Der Expeditionsleiter nahm die Mitteilung, dass ich Diabetes habe, ganz locker auf: „Du lebst seit 10 Jahren mit dieser Krankheit und hast all diese Berge bestiegen. Du musst wohl gut mit dem Diabetes umgehen können. Die Entscheidung für oder gegen den Aufstieg musst du alleine treffen.“ Letztendlich bestand unsere Gruppe aus 11 Bergsteigern. Keiner von ihnen maß meiner Zuckerkrankheit eine besondere Bedeutung bei und das war sehr angenehm für mich. Sie sahen mich im Zelt beim Blutzuckermessen oder im Eis, wenn ich ein Stückchen Haut freimachte, um meine Spritze zu setzen - und es war für sie genauso normal, wie wenn ich an meinen Steigeisen herumhantierte. Die Bergsteiger sind keine „Was ist, wenn passieren...könnte“-Typen. Sonst hätten sie den Aufstieg gar nicht beginnen dürfen. Jeder dreißigste, der diesen oder einen ähnlichen Berg versucht, bleibt für immer am Berg. Kein Mensch ist für 7500m geschaffen. Hier an diesem Berg ist jeder „behindert“, ob er nun Diabetes hat oder nicht, ist eine nebensächliche Feinheit.
Die Besteigung eines Siebentausenders ist wesentlich aufwendiger als die eines Sechstausenders. Drei meiner fünf Sechstausender habe ich in zwei Tagen bewältigt (Auf- und Abstieg). Für das nun geplante Mehr an 1200-1500 Höhenmetern musste ich mit der zehnfachen Zeit rechnen - 20 Tage. Die ersten 10-14 Tage sollten damit vergehen, Lasten in höhere Regionen zu schleppen (wir hatten keine Träger), Hochlager aufzubauen und immer wieder ins Basislager abzusteigen. Durch diese Aktivitäten sollte auch die notwendige Anpassung des Körpers an die große Höhe erfolgen - die Akklimatisation. Danach sollte der eigentliche Auf- und Abstieg erfolgen, für den 5-7 Tage vorgesehen waren.
18.August 1994, der 16.Tag am Berg: Ich hatte es nicht mehr geglaubt, bis hierher zu gelangen. Siebzig Zentimeter Neuschnee und eine hartnäckige Zahnentzündung hatten den Aufstieg sehr schwierig für mich gemacht. Nun befand ich mich in knapp 6900 Metern Höhe in unserem letzten Hochlager. Vier lange Tage hatte ich vom Basislager bis hierher gebraucht. Zu viert verbrachten wir die Nacht in einem Zweimannzelt. Unser zweites Zelt war irgendwo in den Neuschneemassen unauffindbar begraben. Wir legten uns mit unserer gesamten Ausrüstung inklusive Hartschalenschuhe in unsere Schlafsäcke und lagen mehr übereinander als nebeneinander. An Schlafen war nicht zu denken, ans Blutzuckermessen auch nicht. Das Spritzen war nur durch die Rücksichtnahme meiner drei Bergkameraden möglich. Sie durften sich nicht ein bisschen rühren, ich drehte mich mit der Stirnlampe in den Schlafsack ein und vollzog da drinnen meine Prozedur.
Der 17.Tag am Berg: Noch in der Kälte der Nacht verließen wir das Zelt. Schon gestern hatten wir eine kleine windgeschützte Fläche aus dem Eis gehackt. Hier kochten wir nun unser Müsli. Nahrung hatten wir genug, aber keiner von uns brachte etwas runter. Das Essen funktioniert in dieser Höhe nicht mehr so richtig. Wie gut, dass ich nicht vorher für das Frühstück gespritzt hatte. Ich stapfte als erster Richtung Gipfel los. Das Gelände hier war leicht, das Gehen in dieser Höhe aber unheimlich schwer. Knapp drei Stunden stapfte ich so bergan - 15 kleine Schritte, eine halbe Minute Pause. Dann hatte ich laut Höhenmesser 7200 Meter erreicht. Ich sah, dass meine Kraft für die letzten 350 Meter nicht ausreichen würde. Meine Denkkraft und meine Wahrnehmung waren schon ziemlich getrübt durch die große Höhe, ein wirkliches Bewusstsein für die Gefahr hatte ich nicht mehr. Ich tat etwas, was ich in tieferen Lagen wohl nie getan hätte. Ich ließ meinen Rucksack mitsamt meiner ganzen Rückversicherung (Biwaksack, Kleidung, Nahrung, Getränke) im Schnee liegen und stieg ohne Gepäck weiter. Nur mein Insulin, das ich während der gesamten 20 Tage am Berg immer in der Brusttasche trug, um es vor dem Einfrieren zu schützen, und meine Kamera hatte ich bei mir. Mein Geist wurde nun zunehmend trüber, die Dämonen des Berges ergriffen nun vollends Besitz von mir. Meine Freunde, die nun etwa 50 Meter vor mir gingen, sah ich beschwingt Ballett tanzen. Und auch sie hatten, wie sie mir nachher erzählten, ähnliche Haluzinationen. Hans-Peter sah Kletterer mit einem roten VW-Käfer hier oben ankommen. Weitere drei Stunden waren vergangen, eine waagrechte Schneefläche war erreicht, ein unbedeutender Felszacken ragte heraus, nirgends ging es mehr höher hinauf - der Gipfel. Kein großer Jubel - bei keinem von uns. Die Dämonen des Berges hatten uns zu sehr verwirrt, im Grunde wusste ich nicht einmal mehr, was ich hier oben machte. Zudem verwehrte uns der dichte Nebel jede Aussicht. Einige Fotos - eher ein Reflex! Nach einer Viertelstunde begann ich mit dem Abstieg, ein gedankenloses Schrittesetzen. Ich erreichte meinen Rucksack und wenig später kamen auch meine Freunde. Jetzt war unser Kopf wieder freier und wir begannen zu begreifen, was uns gelungen war - jetzt erst umarmten wir uns.
Ich glaube, ich habe meine ganze Kraft beim Aufstieg verbraucht. Die eineinhalb Tage des Abstiegs ins Basislager wurden unendlich lang. Aber mit jedem Meter, den ich tiefer stieg, wurde mein Denken wieder klarer, die Dämonen des Berges gaben mich wieder völlig frei. Und die Dämonen, die vorher zehn Jahre in meinem Kopf gewirkt hatten? Ja, diese Dämonen kamen nie wieder! Sie waren so sehr aus meinem Denken entwichen, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, dass sie je Einfluss auf mich gehabt hatten. Nach zehn Jahren - endlich vollkommen frei! Wie selbstverständlich lag das Bewusstsein vor mir, dass alles, was auf diesem Globus für Menschen machbar ist, auch für mich mit Diabetes möglich ist. Es kann sein, dass mir für eine bestimmte Aktivität physische Kraft und Ausdauer fehlen, dass ich nicht das nötige technische Können besitze oder aber dass mir ganz einfach der Mut fehlt, aber Diabetes wird sicher nicht mehr der Grund sein, mich von etwas abzuhalten.
Die Zeiten haben sich geändert. Vor zweieinhalb Jahren hatte ich noch schüchtern um Aufnahme in die Expedition angesucht und aufgrund meines Diabetes nicht wirklich mit Zustimmung rechnen können. Heute werde ich oft angeschrieben, bei dieser oder jener Expedition in den Himalaya oder ins Karakorum teilzunehmen oder aber im Dschungel Neuguineas neue Routen zu versuchen. Viele von denen, die mich anschreiben, wissen, dass ich Diabetes habe. Es scheint für sie in bezug auf diese Vorhaben keine Rolle zu spielen, und es spielt auch für mich keine Rolle mehr. Ob uns nun ferne Länder oder eine bestimmte Sportart besonders reizen, ob wir hohe Berge besteigen wollen, durch Wüsten und Regenwälder marschieren oder in Korallenriffen tauchen wollen, in nichts von all dem sind wir schlechter gestellt als die Nichtdiabetiker, in nichts von all dem sind wir behindert, außer wir lassen die Behinderung durch unseren Kopf in uns einfließen.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
 |