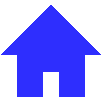Veröffentlichungen / Bücher
Aufbruch in die GrenzenlosigkeitAbenddämmerung
Auszug aus dem Kapitel
Weiße Wände, weißes Bettzeug - die Sterilität des Krankenzimmers hat mich endgültig gefangen genommen. Die letzten Tage waren noch recht abwechslungsreich gewesen. Da lag zwar diese unheilvolle Diagnose im Raum, deren Tragweite ich noch nicht recht begriffen hatte, aber da konnte ich noch frei im Haus herumlaufen, wurde von Untersuchung zu Untersuchung geschickt, bekam unheimlich viel Besuch - ich habe das "Anders-geworden-Sein" noch vor mir herschieben können.
Das ist fürs erste einmal vorbei. Nun hänge ich seit einigen Stunden an dieser Dauerinfusion, die mich ans Bett fesselt und durch die mir Insulin ständig in winzigen Dosen zugeführt wird. Auf diese Weise will man meinen Insulinbedarf herausfinden. Kein Davonlaufen mehr - auch nicht vor mir selbst! Drei Tage soll diese Prozedur noch dauern. Ich wünsche mir, dass die Minuten schneller verrinnen, Schluss mit diesem Ruhighalten, aber die Zeiger der Uhr bleiben ihrem Takt treu. "Schäfchen zählen" - das geht bis dreißig gut, dann lasse ich es wieder bleiben. Ich werde ja doch nicht schlafen - so mitten am Tag.
Das Warten zwingt mich in mich hinein. Ich verschränke die Hände unter meinem Kopf, sehe hinauf zur Decke. Sie ist weiß wie alles hier im Raum, weiß wie eine Leinwand. Da ist noch dieses Video, das es nicht auf Kassette gibt, das nur in meinem Kopf existiert. Unscharf entstehen Bilder einer fremden Welt vor meinen Augen, nehmen Konturen an, fügen sich in einen logischen Ablauf - ein Film aus den Tagen der Freiheit.
Den ganzen Tag war ich von Bäumen, Moos und Wurzeln umgeben gewesen, bin durch knöcheltiefen Schlamm gewatet. Jetzt ist es licht über mir
geworden, ein kleiner See liegt vor mir. Das Sonnenlicht des herannahenden Abends verwandelt die Wasseroberfläche in tanzende Goldplättchen.
Im grünen Dickicht rund um den See erwachen die Urkräfte des Lebens. Vogelschreie durchbrechen die Stille. Die Lebendigkeit des erwachenden
Waldes umgibt mich nun ganz nah, und ich kann sie doch nicht sehen. Irgendwo brechen Äste - ein Wildschwein oder ein Baumkänguruh, das vor uns die
Flucht ergreift. In der Luft mischt sich der stechende Geruch von Fäulnis mit jenem frisch erblühter Blumen.
Ich sauge die Idylle in mich auf, bleibe sitzen und verweile hier ein wenig! Der Zauber dieses Platzes ist verführerisch - und trügerisch. In weniger als einer Stunde wird sich dieses Paradies von seiner feindseligsten Seite zeigen.
Wir haben noch keinen Rastplatz für die Nacht gefunden. Nicht der leiseste Hinweis auf menschliche Existenz - seit Stunden. Da war nur dieser schmale Pfad, dem wir den ganzen Tag lang gefolgt sind. Ich habe ihn kaum erkennen können. Nur meine einheimischen Freunde haben ihn lesen können, die geknickten Äste, die Spuren eines Machetenschlages. Und dieser Pfad gibt Hoffnung, daß es hier im Wald noch andere Menschen gibt. Irgendwo! Irgendwo entlang dieses verwachsenen Weges!
Andere Menschen, eine urzeitliche Kulturinsel inmitten dieser wilden, alles dominierenden Natur, das Flackern eines Feuers, einige Süßkartoffeln, die darin garen, das Gewirr von Stimmen, deren Laute ich wahrnehmen kann ohne ihren Sinn zu verstehen - das ist die Geborgenheit, nach der ich mich jetzt sehne.
Seit geraumer Zeit wiederholt Thomas immer wieder, daß es nicht mehr weit sein kann, dass wir bald die Hütten seiner Verwandten erreichen
müssten. Er kennt diesen Teil des Waldes nicht. Noch nie waren er oder seine Freunde von dieser Seite in den Bergdschungel aufgestiegen.
Ahnungslos und zielstrebig folgen sie dem kaum sichtbaren Faden, der sich durch die gewaltige Weite dieses Waldes am Laiagam-Fluß zieht - ein Pfad,
nur von jenen wenigen begangen, die auf der Suche nach fruchtbarem Boden und freiem Land in die Kälte dieses Berglandes abgedrängt worden
sind und hier ein Leben ohne Zäune, aber auch ohne menschliche Gemeinschaft führen.
Angst hat meine drei Freunde auf diesen verwachsenen Pfad in die Berge, hoch über allen Tälern und Dörfern, getrieben. Sie sind Schüler einer Holzverarbeitungsschule in Wanepap, dort habe ich sie kennengelernt. Ein Todesfall in der Familie hat sie gezwungen, in ihr Dorf südlich des großen Laiagam-Dschungels zurückzukehren. Auf den Hauptwegen tobt seit Monaten ein erbitterter Stammeskrieg, der jeden das Leben kostet, der sich von den über das gesamte Gebiet versprengten Kämpfertrupps erwischen lässt. Nur der kaum begangene Weg über die dreieinhalbtausend Meter hohen Berge erschien den jungen Burschen sicher, für mich die Chance mich anzuhängen, einzutauchen in die Unwirklichkeit einer den Menschen gnadenlos trotzenden Natur.
Der Zauber, die Härten, die Fremdartigkeit dieses Waldes passen vollkommen zum Wesen dieser Insel, auf der mir immer mehr das Bewusstsein verloren geht, mich noch in der realen Welt zu befinden.
Irgendwann in den letzten Tagen und Wochen hat die Wirklichkeit um mich herum ihre Kraft verloren, hat ihre scharfen Konturen verschwimmen
lassen, konnte mich nicht mehr festhalten. Sie hat meine Verhaltensmuster und mein Realitätsbewusstsein aufgelöst, sie hat mich aus der Zeit
gestoßen. Haltlos schwebe ich in diesem Land wie ein Getriebener oder Kobold oder Held in einer fantasy world.
Selbst die Angst hat in dieser fremdartigen Umgebung etwas schattenhaft Unwirkliches an sich. Wie ein Geisterwesen greift sie aus dem Nichts nach mir, stoppt mich - für Augenblicke, ich kann hier selbst die Angst nicht mehr als wirklich begreifen, gehe durch sie hindurch wie durch eine Chimäre. Die grasbewachsene Hochfläche, der immer gleiche Trott im knöcheltiefen Schlamm - und dann dieser Einschnitt, wie mit einem riesigen Messer in die gleichförmige Landschaft hineingezogen. Zwanzig, vielleicht dreißig Meter tief - die schmale Schlucht des Laiagam! Ein einziger Baumstamm führt über diesen Abgrund - nicht behauen, rund und nass. Teil einer Realität, die für mich längst zum Spiel geworden ist! Einen Augenblick nur halte ich inne, ich bleibe nicht stehen, gehe weiter, nehme den schlammigen Pfad auf der anderen Seite der Schlucht wieder auf - ohne zurückzublicken. Kein Erschaudern, kein Durchatmen, kein Begreifen!
Wochen und Monate später holt mich die Angst ein. Ich lese die Eintragungen in meinem Tagebuch, kann die Projektion meiner Diapositive betrachten, begreife, dass das alles kein Traum war. Nun stockt mir der Atem, wenn ich die Tiefe des Abgrunds und den glitschigen Baumstamm vor mir sehe. Nie wieder über solch eine Brücke, raunt es in mir. Die Angst hat mich zu fassen bekommen. Zu spät!
Da sind noch diese Ängste, die nahe bei meinem Krankenbett lauern. Sie sind anders, nicht laut, nicht erschreckend. Sie geben mir Zeit,
mich mit ihnen zu beschäftigen. Ruhig umlagern sie mich und suchen Eingang in meine Gedankenwelt zu finden. Zukunftsängste - entstanden durch den
Katalog an Geboten und Verboten, der mir mit der Diagnose anvertraut wurde, verstärkt durch die mitleidvolle und erschütterte Anteilnahme meiner Umwelt.
Anfangs traf es mich gar nicht so schlimm, als ich die Diagnose meines Hausarztes hörte: "Diabetes - zuckerkrank!" Zum einen wusste ich damals recht wenig mit dieser Diagnose anzufangen, zum anderen war ich erleichtert, nichts Schlimmeres hören zu müssen. In nur vier Tagen hatte sich mein Sehvermögen derart verschlechtert, dass ich nicht mehr ohne Führung auf der Straße gehen konnte. Richtig befreit war ich, als ich erfuhr, dass keine Augenkrankheit an meinem Zustand schuld war, sondern der extrem hohe Blutzuckerspiegel. Besser Diabetes als Blindheit, das war für mich klar.
Wenige Stunden später war ich im Krankenhaus, wo die nötigen Labortests durchgeführt wurden. Ich wurde ins Arztzimmer gerufen, wo die Erstdiagnose meines Hausarztes bestätigt wurde. Gleichzeitig erfuhr ich einiges über meinen neuen Lebensbegleiter: die nächsten Wochen werde ich im Spital zubringen, mein ganzes Leben werde ich Insulin spritzen, meinen Lebensstil und -rhythmus werde ich ändern müssen. Das alles klang nicht gerade verheißungsvoll. Was mich aber wirklich "knickte", war der Tonfall, in dem mir das alles mitgeteilt wurde. Gut gemeint war es, ein Versuch persönlicher Anteilnahme an meinem Schicksal, aber dieses langsam gesprochene "Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie zu einem der wenigen Fälle gehören, die...", warf mich total zurück.
Regelmäßigkeit in der Lebensführung gehörte nicht gerade zu meinen Stärken, ich liebte die dauernde Abwechslung. Sieben Monate war ich in diesem Jahr durch die Welt getingelt, ohne dabei eine geplante Route verfolgt zu haben, die Grenzenlosigkeit eines freien Lebens habe ich genossen. Nun sollte das alles vorbei sein.
Nein, ich werde auch durch diese Ängste hindurchgehen, wie damals an der Schlucht des Laiagam. Hier im Krankenhaus werde ich das Spiel zu Ende spielen. Sie waren alle so nett zu mir, die Ärzte und Schwestern, sie haben meine Sehkraft wiederhergestellt. Ich habe keinen Grund, sie in ihrem Arbeitsstolz zu verletzen, ihnen klarzumachen, dass ihre Diagnosen und Prognosen für mich eben nicht gelten. Hier will ich noch ihren Regeln folgen. Wenn ich wieder nach Hause komme, wird wohl der ganze Spuk zu Ende sein. Solange ich noch in diesem Haus weile, werde ich da sein und doch nicht da sein, werde mir die Unwirklichkeit meiner fernen Insel zur Wohnung meiner Gedanken machen.
Das dichte Gehölz des Waldes hat mich wieder eingefangen. Mein Gesicht streift an den nassen Moosfetzen, die von den Bäumen herabhängen, meine Füße suchen die morschen, abgefallenen Äste auf dem Untergrund zu treffen, um nicht über die Knöchel im Schlamm zu versinken. An allem, was meine Hände zu fassen bekommen, ziehe ich mich über die quer über den Pfad gefallenen Stämme.
Schwer ist es für mich, den Fallen des Waldes bei Tageslicht zu entgehen. Die kurze Dämmerung des Abends gibt mir kaum Zeit, mich auf meine neue Situation einzustellen. In wenigen Minuten herrscht stockdunkle Nacht. Zum Boden hin gebückt, im Schein der Taschenlampe versuche ich, einer Nacht auf dem kalt-feuchten Untergrund zu entgehen.
Wie weit noch? Wie lange noch? Ich komme kaum mehr vorwärts. Tust du einen Schritt, so bist du deinem Ziel wieder ein Stück nähergekommen. Diese banale Weisheit hält mich aufrecht, gibt mir Kraft, geduldig einen Schritt nach dem anderen zu setzen.
Das Blätterdach des Dschungels gibt ein Stück des Himmels frei. Sterne! Aufgeregt leuchte ich den Boden um mich herum mit meiner Taschenlampe aus - eine Lichtung, nicht von der Natur, sondern von Menschen geschaffen. Ich jubiliere. Hier müssen Menschen leben.
Fast wäre ich im Dunkel gegen die Hütte gelaufen. Erst wenige Schritte davor kann ich den schwachen Lichtschein des Feuers erkennen,
der zwischen den Balken hindurch schimmert. Boss zwängt seinen Oberkörper in den winzigen Eingang der Hütte. Ein Wortwechsel!
Der angenehme und freudige Tonfall dieser Konversation macht mich sicher, dass wir in diesem Meer von kaum durchdringbarem Gehölz genau auf jene Menschen
gestoßen sind, die wir gesucht haben.
Ein Mann, knapp an die dreißig, tritt aus der Hütte, vermittelt das Gefühl des Willkommenseins. Ein Tuch, eingezogen in einen Rindengürtel, verhüllt seinen Penis, längliche Blätter sein Hinterteil. Mehr Schutz gegen die frostigen Temperaturen, die nun schon nahe an den Gefrierpunkt gefallen sind, scheint er nicht zu besitzen. Ich will meinen neuen Gastgeber wegen seiner Kälteunempfindlichkeit bestaunen, da streift mein Blick meinen eigenen Körper entlang. Ein Paar zerschlissene Sportschuhe, keine Socken, eine Short, ein T-Shirt! Mein ganzes Hab und Gut baumelt leicht an meiner Schulter- eine kleine Sporttasche mit einem zweiten T-Shirt, einem Sweater, einem Schlafsack, einer Taschenlampe, einem Fotoapparat, einigen Zigaretten, einer Machete. Viel ist mir, dem Wohlstandskind aus Wien, nicht geblieben nach sechs Monaten in Asien und Ozeanien. Die ausgeklügelten Traveller-Utensilien, die vor Monaten meinen Rucksack füllten, sind samt ihrem Behältnis irgendwo auf dem Weg zwischen Pakistan und Neuguinea auf der Strecke geblieben, dem Verschleiß zum Opfer gefallen. Tag für Tag lebe ich aus dem Inhalt meiner kleinen Sporttasche, lasse mich treiben von den Zufälligkeiten einer völlig fremdartigen Welt, weiß nicht, wo ich die nächste Mahlzeit auftreiben kann, weiß nicht, wo ich mich zur Nachtruhe legen kann.
Ich werde sie vermissen, die Spontaneität dieser Tage und Wochen im Busch, die einzig durch den Aufgang und Untergang der Sonne reglementiert wurde.
Niemand hier in diesem Krankenhaus will mir meine Spontaneität wiedergeben. Regelmäßige Mahlzeiten, einheitliche Rationen, pünktliches
Verabreichen der Insulinspritze - das alles lerne ich hier in Kursen. Tage, die so regelmäßig sein werden, dass sie in ihrer
Gleichförmigkeit ihr Antlitz verlieren werden, sich zum Verwechseln ähnlich werden - ja, mit solchen Tagen "darf" ich alt werden.
...Fortsetzung im Buch
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |